Dünger oder Düngemittel ist ein Sammelbegriff für Reinstoffe und Stoffgemische, welche in der Landwirtschaft und im Gartenbau dazu benutzt werden, das Nährstoffangebot für die angebauten [[Kulturpflanze]]n zu ergänzen. Da die von den Pflanzen benötigten [[Hauptnährelement|Haupt-]] und [[Spurennährstoff]]e (s. a. “[[Pflanzenernährung]]“) oftmals nicht in der optimalen Form und Menge im [[Kulturboden|Boden]] bereitstehen, kann durch gezielte Düngergabe schnelleres Wachstum, höhere Erträge und/oder eine verbesserte [[Produkt (Wirtschaft)|Produkt]][[qualität]] erzielt werden. Die Grundprinzipien der Düngung folgen dem “[[Minimumgesetz]]“ und dem “Gesetz des abnehmenden Ertragszuwachses“.
Die Herstellung und Verwendung von Düngemitteln wird in der [[Europäische Union|EU]] durch die sog. “[[Richtlinie 91/676/EWG (Nitratrichtlinie)|Nitratrichtlinie]]“ geregelt, deren nationale Umsetzung in Deutschland die “[[Düngeverordnung]]“ (DüV) ist. Man nimmt an, dass der europäische Markt für Düngemittel bis zum Jahr 2018 ein [[Marktvolumen|Volumen]] von 15,3 Milliarden Euro erreicht haben wird. == Begriffe und Definitionen == Düngemittel werden primär in drei Gruppen unterschieden: * [[Organische Chemie#Stoffgruppen der organischen Chemie|organische]] Dünger ([[#Organische Dünger|s. u.]]), * mineralische Dünger ([[Anorganische Chemie#Anorganische Stoffe|anorganische]] und [[Mineral]]
“Mineralische Dünger“ werden als Einzel- (z. B. [[Kaliumsulfat]]) und als [[Mehrnährstoffdünger]] angeboten. Mineralische Mehrnährstoffdünger, die die Hauptnährelemente [[Stickstoff]] (N), [[Phosphor#Verwendung|Phosphor]] bzw. [[Phosphate#Dünger|Phosphat]] (P) und [[Kalium#Bedeutung als Düngemittel|Kalium]] enthalten, werden [[Mehrnährstoffdünger#Volldünger|NPK-Dünger bzw. Volldünger]] genannt. Viele dieser Volldünger enthalten daneben [[Schwefel]], [[Calcium]] und/oder [[Magnesium#Düngemittel|Magnesium]] sowie Spurenelemente. Letztere werden auch als spezielle „Spurenelementdünger“ angeboten. Eine grundsätzliche Unterscheidung findet daneben auch zwischen “’Kunstdünger“‘ und “’Naturdünger“‘ statt.
Zu den “Kunstdüngern“ zählen sämtliche Düngemittelprodukte, die [[Synthese (Chemie)|synthetisch]] hergestellt werden. Entgegen einer verbreiteten Annahme ist es dabei unerheblich, ob die einzelnen Bestandteile anorganischen bzw. mineralischen Ursprungs sind oder ob sie aus einer organischen Quelle stammen. Des Weiteren werden inzwischen vermehrt “organomineralische Dünger“ eingesetzt, für die ebenfalls der Begriff „Kunstdünger“ verwendet wird.
Im Gegensatz dazu wird “Naturdünger“ stets natürlich hergestellt bzw. nichtsynthetisiert; ob der Ausgangsstoff organischer oder aber anorganischer bzw. mineralischer Natur ist, ist allerdings auch hier irrelevant. [[Stickstoffdünger]] lassen sich pauschal keiner der verschiedenen o. g. Gruppen zuordnen. Es gibt unter ihnen sowohl Kunstdünger als auch Naturdünger, und zwar jeweils sowohl organischen wie auch mineralischen Ursprungs. == Geschichte des Düngers == Seit [[Minoische Kultur|minoischer]] Zeit (ca. 3100 v. Chr.) wurden landwirtschaftlich genutzte Felder zur Steigerung der Ernte mit tierischen und menschlichen [[Fäkalien]] bestreut. Bereits die Römer und auch die Kelten begannen Kalk [[Calciumcarbonat|kohlensauren Kalk]] und [[Mergel]] als Dünger zu verwenden. Um 1840 konnte der Chemiker [[Justus von Liebig]] die wachstumsfördernde Wirkung von [[Stickstoff]], [[Phosphate]]n und [[Kalium]] nachweisen. Stickstoff erhielt man in Form von [[Nitrate]]n zunächst vor allem durch den Einsatz von [[Guano]], einer Substanz, die sich aus den Exkrementen von Seevögeln bildet. Da die Guanovorräte jedoch begrenzt sind und größtenteils aus Südamerika eingeführt werden müssen, sann man auf eine Methode, Nitrate [[Synthese|synthetisch]] zu erzeugen. Zwischen 1905 und 1908 entwickelte der Chemiker [[Fritz Haber]] die [[Katalyse|katalytische]] [[Ammoniak]]-Synthese. Dem Industriellen [[Carl Bosch]] gelang es daraufhin, ein Verfahren zu finden, das die massenhafte Herstellung von Ammoniak ermöglichte. Dieses [[Haber-Bosch-Verfahren]] bildete die Grundlagen der Produktion von synthetischem Stickstoff-Dünger, dem sogenannten {{„-de|Kunstdünger}} (zur Problematik dieses Begriffs siehe Einleitung). Seit dem [[Zweiter Weltkrieg|Zweiten Weltkrieg]] brachte die Industrie vermehrt Düngemittel mit unterschiedlicher Zusammensetzung auf den Markt. Im letzten Viertel des [[20. Jahrhundert]]s geriet der synthetische Dünger jedoch zunehmend in die Kritik, da seine übermäßige Verwendung ökologische Schäden verursachen kann. Seit ca. 1985 sinkt der Verbrauch von mineralischen Düngemitteln in Deutschland. Heutzutage rückt die Produktionssteigerung im Agrarbereich mit der rasant wachsenden Weltbevölkerung immer weiter in den Fokus der Diskussion und somit auch der Bedarf von Dünger. Ein Grund ist zunehmender Wohlstand in Schwellenländern wie China, Brasilien und Indien, der zu einer Veränderung der Ernährungsgewohnheiten führt: Ein erhöhter Fleischkonsum erfordert eine größere Erntemenge und damit auch einen steigenden Düngemitteleinsatz. == Düngerarten == Man unterscheidet Dünger allgemein nach der Art, wie der düngende Stoff gebunden ist. Weitere Unterscheidungsarten sind die Form des Düngers (Feststoffdünger und Flüssigdünger) und deren Wirkung (schnellwirkender Dünger, Langzeitdünger, Depotdünger). Der Zeitpunkt der Düngung wird weiter unterteilt: * Eine “’Grunddüngung“‘ wird vor der Aussaat bzw. Pflanzung ausgebracht. * Die “’Kopfdüngung“‘ wird dagegen durch Ausstreuen von meist gekörnten stickstoffhaltigem Dünger in der Wachstumsphase vorgenommen. === Mineraldünger === Im “’anorganischen Dünger“‘ oder Mineraldünger liegen die düngenden Elemente meist in Form von [[Salze]]n vor (Ausnahmen: Flüssigammoniakdünger). Die Herkunft mineralischer Dünger ist in letzter Konsequenz fast immer in der bergmännischen Gewinnung von Mineralien zu sehen. Meist ist dem Einsatz eine mehr oder minder intensive chemische Veränderung vorgelagert ([[Haber-Bosch-Verfahren]]; Phosphataufschluss mit Säuren). Teilweise kommen aber auch Bergbauprodukte geringeren Veredlungsgrades, z. B. [[Kalisalz]]e und [[Kalkung|Kalk]], zum Einsatz. Mineraldünger haben einen großen [[Produktivitätsfortschritt]] in der Landwirtschaft ermöglicht und werden heute sehr häufig eingesetzt. Problematisch sind die synthetischen Stickstoff-Dünger in Anbetracht des enormen Energieaufwandes bei der Herstellung. Auch bedrohen sie langfristig die mikrobielle Aktivität eines Bodens, da synthetische Düngemittel in der Regel die Arbeit von Mikroorganismen übernehmen. Da Mikroorganismen für die (landwirtschaftliche) Qualität eines Boden jedoch entscheidend sind, kann dies zu Problemen führen. ==== Herstellung ==== {{Siehe auch|Haber-Bosch-Verfahren}} {{Siehe auch|Ostwaldverfahren}} [[Phosphate]] werden grundsätzlich als Rohphosphate oder als aufgeschlossene Phosphate verwendet. Rohphosphate sind schwerlöslich und werden kaum als Dünger verwendet. Deshalb werden Rohphosphate mit [[Schwefelsäure]] bzw. [[Phosphorsäure]] aufgeschlossen. Dadurch entsteht Calciumdihydrogenphosphat bzw. bei Verwendung der Schwefelsäure zusätzlich noch Calciumsulfat. Rohphosphat, das mit Schwefelsäure aufgeschlossen wird, wird als [[Superphosphat]] bezeichnet. [[Tripelsuperphosphat]] oder [[Doppelsuperphosphat]] wird aus Rohphosphat und Phosphorsäure hergestellt und weist einen höheren Gehalt an Phosphor auf. Als Langzeitdünger dient CaNaPO4 * CaSiO4. Dieses ist nicht wasserlöslich und wird durch organische Säuren von den Wurzeln gelöst. Stickstoffhaltige Phosphatdünger wie z. B. Diammoniumphosphat (NH4)2HPO4 ([[Diammoniumhydrogenphosphat|Ammonphosphat]]) oder Monoammoniumphosphat werden aus [[Ammoniak]] und Phosphorsäure hergestellt. Die Verfügbarkeit von metallarmen Rohphosphaten ist ein elementares Marktkriterium für die Herstellung qualitativ hochwertiger Phosphatdüngemittel. Die Ausbeutung metallarmer Phosphatlagerstätten, bzw. der Phosphatmineralien an sich, ist ein Ressourcenproblem der industriellen Zivilisation überhaupt ([[Peak Phosphorus]]). So gingen auf der Pazifikinsel [[Nauru]] die Förderraten ihres Hauptexporterzeugnisses [[Guano]] seit der Mitte der 1970er Jahre kontinuierlich zurück und sind nun versiegt. [[Stickstoffdünger]] sind meist [[Ammoniumnitrat]], [[Ammoniumsulfat]] und [[Kaliumnitrat]] und werden aus [[Ammoniak]] und [[Salpetersäure]] hergestellt. [[Kalisalz]]e werden im [[Salzbergwerk|Bergbau]] gewonnen, aufbereitet (Kaliumchlorid-Dünger) oder zu [[Kaliumsulfat]] umgesetzt. Der Einsatz von Mineraldüngern kann in Granulat- oder Pulverform, häufig als [[Phosphate]] oder [[Sulfate]] oder in flüssiger Form (“Flüssigdünger“) erfolgen. Selbst eine Aufnahme über die Blätter ist begrenzt möglich. Als Erfinder der Mineraldünger bzw. Kunstdünger gilt [[Justus von Liebig]]. ==== Probleme ==== Phosphaterze enthalten Schwermetalle wie [[Cadmium]] und [[Uran]], die über mineralische Phosphatdünger auch in die Nahrungskette gelangen. ==== Beispiele ====
Autor Leonie
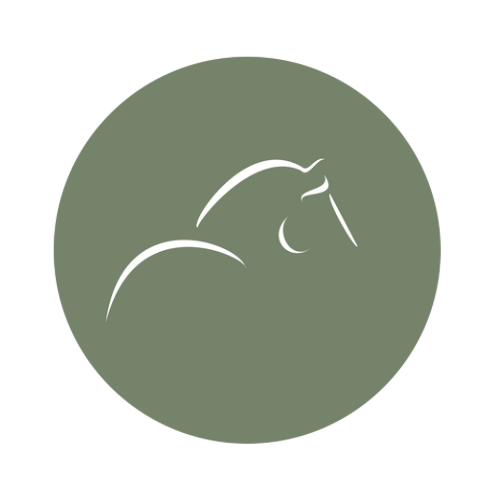
No Comments